Biblische Splitter
Im Extremfall verbindet sich Scham mit dem Wunsch, sich selbst auszulöschen, um den missbilligenden Augen zu entgehen. Scham hat allerdings auch eine lebenszugewandte Seite: Sie schützt das Innen vor dem Aussen, vor dem verachtenden Blick, sie bewahrt die Selbstachtung in schwierigen Situationen, sie zeigt eine Grenze an. Ob lebensdienlich oder nicht: Scham ist ein zentrales Gefühl, sie ist ein religiöses Gefühl, denn sie führt uns zu unserem Ursprung, zurück zur unmittelbaren Beziehung zu Gott.
Adam und Eva
Doch diese Unmittelbarkeit ist schon früh gestört. Die Störung beginnt beim Erwachen der Erkenntnis, so erzählt es die Geschichte vom Sündenfall in 1. Mose 3. Adam und Eva haben trotz des Verbotes vom Baum der Erkenntnis gegessen, nun erkennen und sehen sie, dass sie nackt sind. Scham entsteht. Adam und Eva versuchen, ihre Blösse zu bedecken, weil sie sich voreinander schämen. «Da machten sie sich Schurze». Vor Gott nützen ihnen ihre Verhüllungskünste nichts. Als Gott in der Abendkühle im Garten spazieren geht, verstecken sie sich vor seinem Blick. Doch ihre Scham wird von Gott gesehen und geschützt: «Gott machte dem Menschen und seiner Frau Röcke aus Fell und legte sie ihnen um.»
Psalm 139
Scham ist ein religiöses, ein urtümliches, ein mächtiges Gefühl. Sie setzt sich immer mit der Beziehung zu Gott und dem Verlust von Gottes unmittelbarer Nähe auseinander. Danach sucht der Psalmbeter beziehungsweise die Psalmbeterin des 139. Psalms in ihrer Not. Er wird der Gotteslästerung angeklagt und wartet auf sein Urteil. Er ist des Götzendienstes angeklagt, und steht vor der offiziellen Untersuchung seines Falles. Es geht um Leben und Tod, aber auch um den Verlust des Ansehens, um Ehre und Scham. Trotz Not, trotz Angst und der schambesetzten Gerichtssituation beschwört und besingt der Psalmbeter die Allgegenwart Gottes. Es ist ein Ding der Unmöglichkeit, sich vor Gotte zu entfernen, es gibt keinen Ort ausserhalb des göttlichen Gesichtsfeldes:
Wohin soll ich gehen vor deinem Geist und wohin fliehen vor deinem Angesicht? Stiege ich hinauf zum Himmel, du bist dort, und schlüge ich mein Lager auf im Totenreich, sieh, du bist da. Nähme ich die Flügel der Morgenröte und liesse mich nieder am äussersten Ende des Meeres, auch dort würde deine Hand mich leiten und deine Rechte mich fassen.
Der Psalmist erfährt die sich über Zeit und Raum erstreckende Allgegenwart Gottes nicht als schamauslösend, sondern er glaubt und erfährt, dass Gottes Nähe ihn befreit und erlöst. Es gibt allerdings auch die Schattenseite der Scham, ihre Risiken und Nebenwirkungen, welche auf den Verlust der Unmittelbarkeit aggressiv reagiert. Es geht um alles, um Kopf und Kragen, und gleichsam, als Schatten und Risiko der Scham erscheint der gewaltige Zorn des Beters:
Ach, Gott, wolltest du doch den Frevler töten! Dass doch die Blutgierigen von mir wichen! […] Sollte ich nicht hassen, HERR, die dich hassen, und verabscheuen, die sich gegen dich erheben? Ich hasse sie mit ganzem Ernst; sie sind mir zu Feinden geworden.
Diese Worte des Psalmisten zeugen von einer Leidenschaft, einer Gottesliebe, sie zeugen von verletzter Scham, die zuweilen in Angst und Verwünschung gegen andere ausbricht.
Das Leugnen des Petrus und der gnädige Blick Jesu
Die dunkle Seite der Scham zeigt sich in dem Unterschied zwischen dem, wie Menschen gerne wären, und dem, wie sie tatsächlich sind. Doch als wäre diese Erkenntnis nicht genug, kommt dazu der Blick von aussen, das Erkanntwerden dieser Tatsache, welches die Scham erst recht verstärkt. Dies empfindet Petrus, der Jünger Jesu, nachdem er seinen Herrn verleugnet hat. Er, der sich so prahlerisch, grosssprecherisch hervortat, er, der bereit war, mit Jesus ins Gefängnis und in den Tod zu gehen, hört, wie der Hahn dreimal kräht, so, wie es Jesus angekündigt hat. Das Lukasevangelium hat einen entscheidenden Zusatz. In dem Augenblick, als der Hahn kräht, dreht Jesus sich um und schaut den Petrus an. Der Blick des Anderen, der Blick Jesu ist es, der die Wende bringt:
„Und der Herr wandte sich und sah Petrus an. Und Petrus gedachte an des Herrn Wort, wie er zu ihm gesagt hatte: Ehe heute der Hahn kräht, wirst du mich dreimal verleugnen. Und Petrus ging hinaus und weinte bitterlich.“ (Lk 22, 61f). Petrus schämt sich und weint über sein gebrochenes Versprechen.
Du sollst nicht beschämen
Die Notwendigkeit, die Scham zu achten und zu schützen, scheint heute in Vergessenheit geraten zu sein. Im jüdischen Glauben ist dieses Wissen in den ethischen Geboten bewahrt. Es geht vor allem darum, andere nicht zu beschämen und sie nicht blosszustellen.
Es ist besser, ein Mensch werfe sich in einen Feuerofen, als dass er einen anderen Menschen öffentlich beschäme.
Jemanden zu beschämen ist Sünde:
Wer den anderen beschämt, handelt, als ob er Blut vergösse!
Die Schamgrenzen der anderen zu wahren und zu achten, ist das ethisch Gebotene.
Denn: Scham ist ein Gefühl, sie kann sich nicht irren. Sie hat nicht recht oder unrecht. Genauso wenig, wie wir sagen können, «Schäm dich», können wir jemandem gebieten, sich nicht zu schämen.
Scham und Gewalt
Das Spiel mit der Scham ruft Gewalt hervor und zerstört. Sie ist die natürliche Mitgift, die im Umgang mit Kindern und Jugendlichen entweder gehegt und respektiert oder beschädigt und zerstört werden kann, zum Beispiel durch häufige Beschämung.
Wichtig scheint mir die Frage danach zu sein, wie Scham respektiert und falsche Scham geheilt werden kann. Denn beides ist wichtig: Ein Ja zur Scham, und ein Nein zu einer falsch verstandenen, lebenszerstörerischen Scham. Dietrich Bonhoeffer schreibt: «... Überwindung der Scham kann es nur geben, wo die ursprüngliche Einheit wieder[her]gestellt ist, wo der Mensch wieder bekleidet wird durch Gott und den anderen Menschen, durch die 'himmlische Behausung' ... (2 Kor 5,2 ff).» Sie kann da entstehen und heil werden, wo Menschen respektiert und ihre körperlichen und seelischen Grenzen geachtet werden. In der Beziehung der Eltern zu ihrem Kind, in der Beziehung von Freunden und Freundinnen, in der Beziehung von Lehrerinnen und Schülern, in der Beziehung, im Gegenüber von Gott und Mensch.
Der Psalm betet, er beschwört, er lobt das Gegenüber Gottes, das seine Scham achtet und sein Innerstes erkennt: Du hast mich angesehen, du kennst mich, seit meinen kleinsten Anfängen. Du hast mich gebildet. Deine Augen sahen mich, bevor ich bereit war.
Die Bestätigung der Liebe, die unendlich freundliche Zuwendung kann die Scham schützen und das durch Beschämung Zerstörte heilen: Du bist wertvoll, von Anfang an, dieses Wissen um deine Würde und um deinen unverletzlichen Kern soll geschützt werden. Niemand hat das Recht, dich als Mittel zum Zweck zu gebrauchen. Man muss sich selbst lieben, um sich schämen zu können: Wir sind geliebt, deswegen können wir uns schämen, ohne uns und andere zu zerstören. Das Wissen wird zu Glauben, Glauben wird zum Dank und zum Gebet.
Ich danke dir, dass ich wunderbar gemacht bin. Wunderbar sind deine Werke, das erkennt meine Seele.





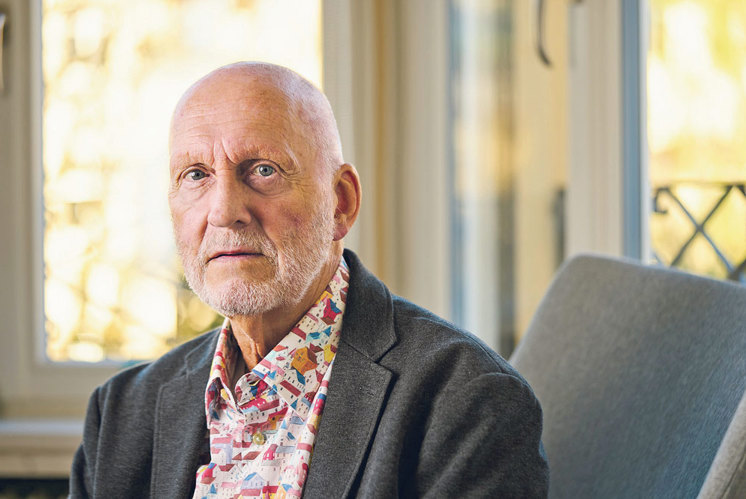



Biblische Splitter