Die tabuisierte Emotion
Die Anpassungsscham
Sie richtet sich nach aussen und orientiert sich an den tatsächlichen oder vermeintlichen Bewertungen von Mitmenschen.
Scham in Bezug auf die Werte einer Gruppe oder der Gesellschaft
Wenn wir Normen oder Werten einer Gesellschaft nicht entsprechen, empfinden wir Scham. Beispielsweise gilt es als gut, fleissig und arbeitsam zu sein. Wer arbeitslos ist, schämt sich daher oft, manche tun so, als würden sie weiterhin zur Arbeit gehen. Soziale Schwäche ist auch schambehaftet, manche brechen beim ersten Gang zur Sozialhilfe in Tränen aus. Mit Scham verbunden sind psychische Erkrankungen, denn sie sind Ausdruck dafür, dass die betroffene Person in irgendeinem Bereich nicht den Normen und Vorstellungen der Gesellschaft entspricht. Verletzung von Höflichkeitsregeln lösen Scham aus. Ebenso nichtkonforme Gefühle (zum Beispiel keine Trauer empfinden nach einem Todesfall). Und schliesslich die Zugehörigkeit zu einer diskriminierten Gruppe.
Körperscham
Hierzu gehören alle Körperformen, die nicht der «Norm» entsprechen. Zu dick, zu dünn, zu klein, zu gross, zu schwächlich, zu gebrechlich. Diese Art von Körperscham wird kräftig gefördert durch die propagierten Schönheitsideale und den boomenden Markt der plastischen Schönheitschirurgie. Sichtbare Male durch Krankheiten (wie Hautkrankheiten) gehören zu ihr. Die «falsche» Hautfarbe löst sie ebenfalls aus. Beeinträchtigung oder Verlust der Körperkontrolle (neurologische Erkrankungen, aber auch Para- und Tetraplegie) sowie auch kurzfristige Verluste über dieselbe gehören dazu (Stolpern, Ungeschicklichkeiten).
Kultur- und geschlechtsspezifische Scham
In Gesellschaften mit klar definierten Rollen für männliches und weibliches Geschlecht gelten alle Rollenüberschreitungen als schambehaftet. Wenn ein Mann Frauenarbeit verrichtet, wird er ausgelacht und beschämt. In archaischen patriarchalen Kulturen gilt die Ehre eines Mannes als beschämt, wenn die Tochter vorehelichen Geschlechtsverkehr hat, selbst wenn sie vergewaltigt worden ist. Überhaupt liegt eine tiefe, geschlechtsspezifische Scham im Frausein an und für sich. Denn die Frau gilt als das Abgeleitete (Eva aus Adams Rippe), als das Minderwertige, das Unvollkommene. Eine weitere geschlechtsspezifische Scham kommt hinzu bei Menschen, die nicht gängigen, vorgeprägten Bildern von Mann und Frau entsprechen (Queers). Potenziert wird diese Scham in Familien, Religionsgemeinschaften, Kulturen und Ländern, in welchen die Rollenerwartungen besonders stark ausgeprägt und festgeschrieben sind.
Wer sich zu nichtkonformen Personen bekennt, braucht Zivilcourage.
Gruppenscham
So wird die Scham bezeichnet, bei welcher man sich für eine andere Person schämt, welche nicht der eigenen Gruppe entspricht. Normalerweise ist dies ein Phänomen, das vorübergehend im Teenageralter auftritt gegenüber den eigenen Eltern, die dann «peinlich» sind. Was eine normale pubertäre Entwicklung ist, kann tiefer gehen, wenn Eltern ernsthafte Probleme haben (Sucht, Gewalttätigkeit, Armut, psychisch krank). Wenn wir mit einer Person gesehen werden, die nicht gesellschaftskonform oder nicht konform zu der Gruppe ist, in der wir uns gerade bewegen, kann dies Scham auslösen. Wer sich zu nichtkonformen Personen bekennt, braucht Zivilcourage (jüdische Freunde im Nationalsozialismus).
Empathische Scham
Sie kommt zum Zug, wenn wir zu Zeugen werden, wie ein anderer Mensch erniedrigt und beschämt wird. Wir schämen uns dann mit der anderen Person und für sie, wissen nicht, wohin schauen oder was sagen. Dies liegt an unseren Spiegelneuronen, welche die Fähigkeit zur Empathie ermöglichen. Wir empfinden die Erniedrigung eines anderen Menschen, als würde sie uns selbst widerfahren. Ich erinnere mich lebhaft an eine Episode vor vielen Jahren im Garten. Ich hörte unfreiwillig mit, wie ein Mann seine Frau beschimpfte und demütigte. Tief duckte ich mich hinter die Sträucher, damit die Frau nicht mitbekäme, dass ich Zeugin ihrer Beschämung war. Erst die Lektüre von Marks deutete mir meine eigene Reaktion.

Intimitätsscham
Wie bereits im Wort enthalten, geht es bei dieser Scham um die Wahrung der eigenen körperlichen und seelischen Intimitätsgrenzen. Welche körperlichen Grenzen als intim gelten, ist kulturell unterschiedlich definiert. Das Gebot zur Bedeckung der Kopfhaare der Frau in einem Gottesdienst (1. Kor 11,6) lag an der damaligen und bis heute im Vorderen Orient gültigen Verbindung der Erotik und Intimität mit den Haaren der Frau. Obwohl die Intimitätsscham des weiblichen Haares in anderen Weltgegenden nicht mehr gilt, haben sich die religiösen Gebote im orthodoxen Judentum sowie im Islam weltweit gehalten, sowie in Kopfbedeckungen von Nonnen und Diakonissen. Intimitätsscham erfahren wir auf körperlicher Ebene durch Verletzung der eigenen Würde oder auf seelischer Ebene durch öffentliche verbale Demütigung (Trump und Vance gegen Selensky), Mobbing, Herabgesetztwerden oder Nichtbeachtung. Wenn wir früh Verletzungen der Intimitätsscham erlitten haben, kann es dazu führen, dass wir auf seelischer Ebene ständig aktiv regulieren müssen, wieviel wir von uns zeigen. Das kann unter Umständen intime Begegnungen erschweren. Dann ist diese Form von Scham traumatisierend. Wenn Intimitätsgrenzen gewaltsam verletzt werden, wird oft die Sichtweise der Täter verinnerlicht («ich habe es nicht anders verdient», «ich bin eine Hure», «ich bin selbst schuld»). Das Opfer schämt sich! Gisèle Pelicot hat den berühmten Satz gesprochen im Prozess gegen ihren Mann und ihre Vergewaltiger: «Die Scham muss die Seiten wechseln!».

Gewissensscham
Diese entsteht, wenn wir nicht gemäss den Normen unseres eigenen Gewissens handeln. Täter in einem Krieg, die Frauen und Kinder ermorden, fühlen in der Regel Gewissensscham. Leider gibt es solche, die keine mehr empfinden oder Normen haben, welche von Anfang an solche Taten möglich machen und rechtfertigen. Der Weg zur Wiedererlangung der Gewissensscham liegt darin, sich der eigenen Täterschaft zu stellen und sie anzunehmen. Allzu oft wird aber eine Gewissensscham verdrängt. Sich ihr zu stellen, braucht grossen Mut. Ich erinnere mich, als vor etlichen Jahren ein über 90-jähriger deutscher Mann im Spital mir weinend gestand, wie er als junger Mann in der Wehrmacht beteiligt war, als man einen jungen feindlichen Soldaten erschoss, der von einem Ehepaar versteckt wurde. Hätte er den Befehl verweigert, wäre er selbst erschossen worden. «Das war doch noch ein Junge!».
Gewissensscham tritt auch dann auf, wenn wir uns menschlich weiterentwickeln, Reifeprozesse durchlaufen und ein Ich-Ideal durchbrechen, weil wir es als nicht immer hilfreich oder gar lebensfeindlich erachten. Ein Beispiel: Menschen, die stark verinnerlicht haben, für andere da zu sein, bekommen oft ein schlechtes Gewissen, wenn sie eigene Bedürfnisse erkennen und auch erfüllen. Sie empfinden sich als egoistisch. Mit anderen Worten, die Gewissensscham ist angemessen, wenn wir andere Menschen verletzen, aber sie kann uns manchmal auch bei Reifeprozessen ausbremsen. Gewissensscham zeigt an, ob wir unser Ich-Ideal, unsere Werte verletzt haben. Sie zeigt an, ob wir unsere Menschlichkeit aufgegeben haben, ob wir uns haben korrumpieren lassen. Und sie erinnert uns an unversöhnte Schuld. Letztere erfordert, sich zu entschuldigen und sie wenn möglich wieder gutzumachen.
Jesus hat mit seiner Nacktheit am Kreuz Schuld und Scham auf sich genommen. Ein bewusster Umgang mit eigener und fremder Scham führt dazu, einander gewaltfrei in Würde und Respekt zu begegnen.


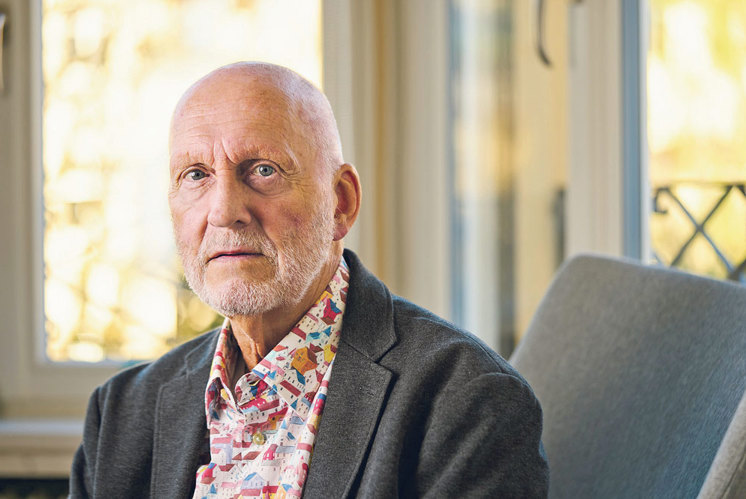



Die tabuisierte Emotion