Vom Wesen der Freundschaft
Dass Begriffe wie Freund und Freundin in digitalen Netzwerken leichtfertig und inflationär verwendet werden, tut dem wahren Wesen und Wert der Freundschaft keinen Abbruch. Wir können sehr wohl zwischen guten Freunden und flüchtigen Bekannten unterscheiden. Von einem richtigen Freund wissen wir ungleich mehr, als was dieser im Internet oder anderen Kanälen von sich preisgibt. Im echten Leben beginnt Freundschaft schliesslich auch nicht mit einer formellen Freundschaftsanfrage, die man per Klick annimmt oder ablehnt und die letztlich kaum Folgen hat. Lässt sich der Beginn einer Freundschaft überhaupt mit einem Datum beziffern? Gibt es so etwas wie «Freundschaft auf den ersten Blick»?
Freundschaft um ihrer selbst willen
Für die meisten von uns nimmt eine Beziehung erst mit der Zeit, durch wachsende Nähe und gemeinsame Erlebnisse und Interessen freundschaftliche Züge an. Mit den unverbindlichen Online-Kontakten und zahllosen Alltagsbegegnungen hat das wenig zu tun. Wir bewegen uns in einem sozialen Gefüge. Dazu gehören nähere und beiläufige Bekanntschaften, Familienmitglieder, Nachbarn, Kameradinnen und Kameraden aus Vereinen, Angehörige der Glaubensgemeinschaft, zeitweilige Weggefährten, Arbeits- und Stammkollegen, «Gspänli» aus der Schulzeit oder einfach Menschen, mit denen wir uns aufgrund gemeinsamer Themen (oder Freunde) verbunden fühlen.
«Auch wenn man sich längere Zeit aus den Augen verloren hat, stellt sich diese Intimität sofort wieder ein.»
Was hebt nun die Freundschaft aus diesem Beziehungsnetz heraus? Was braucht es, damit Freundschaft entsteht und erhalten bleibt?
Schon Aristoteles unterscheidet zwischen oberflächlichen und tiefen Freundschaften.
Gemeinsame Vergnügungen können für freundschaftlichen Zusammenhalt sorgen, oder Vorteil und Nutzen stehen im Vordergrund. Solche Freundschaften sind in der Regel nicht von Dauer, weil es dabei um Annehmlichkeiten und nicht um den anderen Menschen geht. Anders verhält es sich mit der Charakterfreundschaft. «Wahre Freundschaft ist keine blosse Zweckbeziehung», hält der Philosoph Wilhelm Schmid in seinem Büchlein Vom Glück der Freundschaft fest, «sie trägt ihren Zweck vielmehr in sich selbst: Den anderen einfach nur zu mögen und gerne mit ihm zusammen zu sein.»
Freundschaft mit V
Freundschaft schreibt sich mit F, aber viele der Eigenschaften und Begriffe, die wir damit assoziieren, beginnen – wie das mittelhochdeutsche vriuntschaft – mit dem Buchstaben V.
Vertrauen: Freundschaftliche Verbundenheit gründet in einem tiefen gegenseitigen Vertrauensverhältnis. Dieses wird über die Jahre aufgebaut und erfährt immer wieder Bestätigung durch Wertschätzung, Wohlwollen und wechselseitigen Austausch. Man zieht Freunde ins Vertrauen, weil man auf ihre Verschwiegenheit zählt, weil sie Verständnis für unsere Situation haben, uns die Wahrheit zumuten, uns aber nicht vorschnell verurteilen.
Vergangenheit: Erfahrungen und Erinnerungen, die man teilt, bilden die Basis für eine gemeinsame Geschichte. Freunde durchleben Vergnügen wie Verdruss miteinander. Was man zusammen erlebt hat, verbindet, schafft Berührungs- und Bezugspunkte und trägt zu einer wachsenden und dauerhaften Vertrautheit bei. Auch wenn man sich längere Zeit aus den Augen verloren hat, stellt sich diese Intimität sofort wieder ein.
Verlässlichkeit: Freundinnen und Freunde sind für uns da, wenn wir in Not sind oder ein offenes Ohr brauchen. Ohne Vertrag oder offizielle Verpflichtung gilt in der Freundschaft eine unausgesprochene Verbindlichkeit. Auf Freunde ist Verlass – manchmal bedingungslos und bis in den Tod. Deshalb sind Verrat und Vertrauensbruch unter Freunden besonders schwer zu verkraften.
Verständigung: Trotz Unterschieden muss in der Freundschaft eine gewisse Einigkeit über Grundwerte herrschen. «Wie viel Verschiedenheit verträgt die Freundschaft?», fragt schon Aristoteles. Freundschaft duldet individuelle und gesellschaftliche Gegensätze und kann diese überwinden. Aber Ungleichheit in zentralen Lebensfragen stört die Eintracht. Umso wichtiger sind deshalb Aufrichtigkeit und das offene Gespräch – oder stillschweigendes Einverständnis.
Freundschaft als Lebensgemeinschaft
Wenn Freunde uns verlassen, bedeutet dies einen schmerzlichen Verlust, denn mit dem Freund oder der Freundin geht immer auch ein Teil von uns. Vor allem im fortgeschrittenen Leben hinterlassen enge Freunde eine Lücke, die schwer zu füllen ist. «Es mehren sich die Toten als Freundeskreis», heisst es lakonisch in Max Frischs Erzählung Montauk. Neue Bekanntschaften mag man leicht wieder knüpfen, aber um eine tiefe und dauerhafte Freundschaft muss und möchte man sich verdient machen.
Dass wir Freunde brauchen, im Glück wie im Unglück, steht für Aristoteles ausser Frage. Der Mensch ist von Natur aus auf das Zusammenleben angelegt, und Freundschaft bedeutet Gemeinschaft des Lebens. Intensive Freundschaft ist allerdings nur mit wenigen möglich. Für Aristoteles gründet sie – wie im Neuen Testament – auf Selbstliebe und Nächstenliebe: «Denn die Freundschaft ist eine Gemeinschaft, und wie ein Mensch sich zu sich selbst verhält, so verhält er sich auch zum Freund.»
Text: Daniel Ammann, St.Gallen | Foto: as – Kirchenbote SG, Juni / Juli 2015


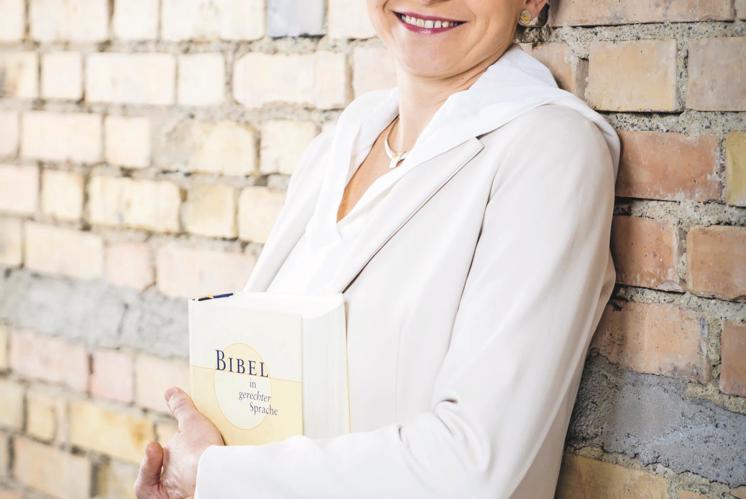
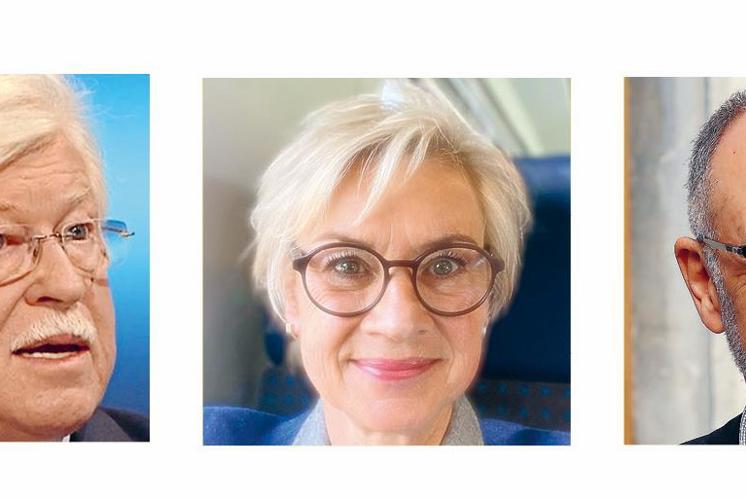

Vom Wesen der Freundschaft